In dieser kompakten Zusammenfassung erfahren Sie in nur 7 Minuten alles Wichtige aus meiner Knowledge-Session "Messen mit Mehrwert“ (im Original: ”Measuring What Matters“)
Bei meiner Arbeit mit internationalen Innovationsteams stoße ich immer wieder auf dieselbe Frage, in verschiedensten Varianten formuliert: Wie lässt sich Innovation so messen, dass das Ergebnis Führungskräfte wirklich überzeugt?
Das ist eine der kniffligsten Herausforderungen in unserem Bereich – aus gutem Grund.
Innovation folgt nicht dem Rhythmus von Quartalszahlen. Sie ist per Definition unvorhersehbar. Trotzdem verlangen Führungskräfte immer häufiger den Nachweis, dass sich Innovationsarbeit lohnt – und zwar nicht anhand von Aufwand oder Beteiligung, sondern anhand von Ergebnissen.
Um diesen Erwartungen gerecht zu werden, müssen Innovationsverantwortliche neu denken: Wie messen wir unsere Arbeit? Wie kommunizieren wir sie? Und wie strukturieren wir sie?
Es geht nicht darum, Vergangenes zu dokumentieren, sondern darum, aufzuzeigen, wohin die Reise geht – und warum das zählt.
Warum Innovationsmetriken oft ins Leere laufen
Viele Innovationsteams messen das Falsche: die Anzahl eingereichter Ideen oder die Anzahl beteiligter Personen. Das zeigt zwar Aktivität – hilft aber der Führung nicht bei Entscheidungen über Ressourcen, Prioritäten oder strategische Richtung.
Woher kommt dieses Missverständnis?
- Innovation braucht Zeit – Führung will schnelle Rückmeldung
- Teams wissen oft nicht, worauf sie überhaupt hinarbeiten sollen – oder wann mit Ergebnissen zu rechnen ist
- Metriken unterscheiden sich stark zwischen Abteilungen – das sorgt für Verwirrung
- Es fehlt eine gemeinsame Sprache zwischen Innovation und Führung
Die Folge: Frust auf beiden Seiten. Die Teams arbeiten an Dingen, die sie für relevant halten. Die Führung erkennt den Wert nicht. Die Programme verlieren an Schwung.
Was Führungskräfte wirklich interessiert
Um diesen Bruch zu überbrücken, lohnt sich ein Perspektivwechsel:
Es geht nicht um die Frage, was für Ihr Innovationsteam wichtig ist – sondern:
Welche Informationen braucht die Führung, um gute Entscheidungen zur Innovation treffen zu können?
In den meisten Fällen geht es um Klarheit zu folgenden Punkten:
- Woran wird aktuell gearbeitet?
- Wann sind Ergebnisse zu erwarten?
- Welche Potenziale gibt es – finanziell, strategisch, operativ?
- Ist das der sinnvollste Einsatz von Zeit, Geld und Talenten?
- Passt das zur strategischen Ausrichtung des Unternehmens?
This shift—Dieser Perspektivwechsel – von Aktivität zu Wirkung – ist der Kern glaubwürdiger Innovationsmessung.
Das Innovationsportfolio: Struktur mit Weitblick
Eine der wirksamsten Möglichkeiten, den Impact von Innovation zu messen, ist die Betrachtung als Portfolio. Ganz wie ein Finanzportfolio sollte auch das Innovationsportfolio diversifiziert, gemanagt und kontinuierlich bewertet werden.
Ein sinnvoller erster Schritt ist die Einteilung nach Zeithorizonten:
- Horizont 1: Inkrementelle Verbesserungen bestehender Produkte, Services oder Prozesse
- Horizont 2: Angrenzende Innovationen, die neue Märkte oder Kategorien erschließen
- Horizont 3: Transformationale Wetten mit Potenzial zur Neudefinition des Geschäftsmodells
- Erwarteter Wert über alle Zeithorizonte hinweg
- Risikoverteilung im Gesamtportfolio
- Umsetzungsraten und Time-to-Value
- Resonanz bei Nutzer:innen und Early Adopters
- Nachhaltigkeit und sozialer Impact (wo sinnvoll)
Diese Struktur erlaubt es der Führung, nicht nur zu sehen, was läuft, sondern warum es relevant ist.
Kennzahlen mit Mehrwert
Sie wissen nicht genau, welche KPIs oder KRIs Sie in den Fokus rücken sollten?
Hier eine erprobte Auswahl – basierend auf den Prinzipien der Innovationsbewertung ("Innovation Accounting") und bewährten Ansätzen aus der Praxis:
Engagement & Kultur
- Anteil der Mitarbeitenden (in %), die aktiv zu Innovation beitragen
- Anzahl genutzter Kampagnen oder Kanäle
- Abgedeckte Themenbereiche entlang strategischer Prioritäten
- Beteiligung über Abteilungen oder Regionen hinweg
- Investierte Stunden in Schulung und Kompetenzaufbau
Portfolio-Gesundheit
- Erwarteter Wert der aktiven Innovationspipeline
- Risikoverteilung über Projekte in Horizont 1/2/3
- Durchschnittliche Zeit von der Idee bis zur ersten Validierung
- Anzahl verworfener Ideen (z. wegen fehlender Passung oder geringem Potenzial)
- Umsetzungsrate im Zeitverlauf
Business Impact
- Generierter Umsatz oder erzielte Kosteneinsparungen
- Realisierter Wert nach Jahr (z. 5 Mio. $ bis Geschäftsjahr 2026)
- Relevante Nachhaltigkeits-/ESG-Kennzahlen
- Performance-Trends nach Geschäftsbereich oder Branche
Nicht alle Kennzahlen müssen gleichzeitig genutzt werden.
Aber: Schon eine kleine Auswahl, konsequent gemessen, kann den Unterschied machen – indem sie Innovationsarbeit sichtbar und bewertbar macht.
Besonders aussagekräftig wird die Messung, wenn sie sich am Innovationsprozess selbst orientiert – von den ersten Inputs bis zu messbaren Ergebnissen. Hier ein strukturierter Überblick:
| Input | Throughput | Output |
| Anzahl an Ideen oder generischen Einreichungen |
Geschwindigkeit beim Testen von Hypothesen (Tage, Monate, Jahre) | #Anzahl oder Anteil geprüfter, bewerteter und/oder umgesetzter Ideen im Vgl. zu Gesamtideen |
| Anzahl an Innovationsaktivitäten oder -initiativen (ggf. nach Kategorie) | Geschwindigkeit beim Aufbau neuer Fähigkeiten (in Tagen, Monaten, Jahren) | Quantifizierbares Wachstum (ROI, Gewinn, Marktanteil etc.) |
| Anzahl neuer externer Daten- oder Wissensquellen (implizit/explizit; frei oder kostenpflichtig) | Anteil oder Anzahl Mitarbeitender und Führungskräfte mit Innovations-Know-how (Ideenfindung, Stategy, Partnering etc.) | Quantifizierbare Verhaltens- oder Einstellungsänderung (z. B. laut Kultur-Umfrage) |
| Anzahl neuer interner Erkenntnisse, Ressourcen und Kompetenzen (auch bei Lieferanten oder Partnern) | Neue eingesetzte Tools und Methoden | Anzahl neuer Partner, Kollaborationen oder interner Nutzergruppen |
| Gegenwartswert von Ideen |
Time-to-Market oder Time-to-Profit (in Tagen, Monaten, Jahren) | Innovationsdiffusion, Erneuerungsrate, entstandenes geistiges Eigentum (IP) |
| Engagement-Analyse (Awareness, Verständnis, Handlung, Reaktion, Advocacy) | Nachhaltigkeitswirkung oder -nutzen | |
| Markenbekanntheit (bei externen Programmen) | Kosteneinsparungen |
Ein Dashboard, das Führungskräfte überzeugt
Selbst mit den passenden Metriken braucht es ein Format, das diese übersichtlich und verständlich zusammenführt. Hier kommt das Innovations-Dashboard ins Spiel – kompakt, klar strukturiert und auf das Wesentliche fokussiert.
Man kann es sich als eine einzige Folie oder Ansicht vorstellen, die die Innovationsstory auf einen Blick vermittelt. Nicht kompliziert – aber klar in der Aussage.
Zentrale Bestandteile eines wirkungsvollen Dashboards:
- Aktive Innovationspipeline, segmentiert nach Reifegrad (z. B. Idee, Proof of Concept, Skalierung, umgesetzt)
- Zeitliche Einordnung: kurzfristige, mittelfristige und langfristige Vorhaben
- Erwarteter Impact (nach Jahr oder strategischem Ziel)
- Entwicklung der Umsetzungsrate im Zeitverlauf
- Risiko- bzw. Investitionsverteilung im Portfolio
- Strategische Zuordnung (z. B. nach Geschäftszielen oder Themenfeldern)
- Uptake- oder Validierungsmetriken (z. B. Anzahl von Pilotierungen oder Nutzerrückmeldungen)
Mit einer klaren Visualisierung dieser Elemente ermöglichen Sie der Führung:
- zu erkennen, wo etwas passiert
- zu verstehen, was als Nächstes kommt
- einzuschätzen, wann mit konkretem Wert zu rechnen ist
- gezielt zu entscheiden, wo Unterstützung oder Skalierung sinnvoll ist
Ein gutes Dashboard informiert nicht nur – es schafft Vertrauen.
Typische Fallstricke – und wie man sie vermeidet
Wenn die genutzten Metriken nicht dabei helfen, Glaubwürdigkeit aufzubauen, lohnt sich ein kritischer Blick auf das Reporting.
Folgende Punkte sollten vermieden werden:
- Nur Volumen berichten. Die Anzahl von Ideen sagt noch nichts über Fortschritt aus.
- Übermäßiger Fokus auf Beteiligung. Engagement ist großartig – aber Wirkung zählt mehr.
- Ausschließlich auf “Moonshots“ setzen. Die richtige Balance ist entscheidend – auch inkrementelle Erfolge sind wertvoll.
- Unbeeinflussbares messen. Was nicht steuerbar ist, erzeugt nur Rauschen.
- Unterschiedliche Metriken in jeder Abteilung. Ohne Konsistenz entsteht keine gemeinsame Erzählung.
Fortschritt sichtbar machen
Ein häufiger Fehler von Innovationsteams besteht darin, sich zu stark auf Endergebnisse zu fokussieren. Doch in den meisten Fällen erwartet die Unternehmensführung nicht sofortige Resultate – sondern Belege dafür, dass Fortschritte gemacht werden.
Was hilft, ist eine Visualisierung des Innovationspfads:
- Bilden Sie Ihre aktive Innovationspipeline ab – inklusive Frühphasen-Ideen, Proofs of Concept und Skalierungsinitiativen
- Ordnen Sie jeder Initiative erwartete Wertspannen und Lieferfristen zu
- Heben Sie Meilensteine für Kompetenzaufbau und Lernfortschritte hervor – nicht nur kommerzielle Ergebnisse
Auch wenn viele Vorhaben noch vor der Umsatzphase stehen: Die Verbindung zu langfristigen Zielen aufzuzeigen, stärkt das Vertrauen – und erleichtert die Ressourcenfrage.
Wo anfangen?
Falls Ihr Innovationsimpact aktuell noch nicht systematisch gemessen wird, gibt es eine gute Nachricht: Nicht alles muss auf einmal gelöst werden!
Ein praktikabler Einstieg wäre wie folgt:
- Analysieren Sie den Status quo: Welche Kennzahlen werden aktuell erhoben? Sind sie aussagekräftig? Passen sie zur strategischen Ausrichtung?
- Starten Sie im Kleinen: Wählen Sie ein Team, eine Abteilung oder ein Innovationsprogramm, um ein neues Messmodell gezielt zu pilotieren.
- Entwickeln Sie eine gemeinsame Sprache: Klären Sie gemeinsam mit der Führung, was “Wert“ in Ihrem Kontext bedeutet – und leiten Sie daraus passende Indikatoren ab.
- Setzen Sie ein Zeichen: Warten Sie nicht auf Freigabe – zeigen Sie, wie gute Innovationsmessung aussehen kann. Erstellen Sie ein einfaches Dashboard und machen Sie Fortschritt sichtbar.
- Steuern Sie Erwartungen aktiv: Kommunizieren Sie klar, wann mit Ergebnissen zu rechnen ist – abhängig vom Reifegrad der jeweiligen Initiative.
Innovationswirkung ist ein Dialog
Das Messen von Innovation folgt keinem Standardmuster. Doch eines hat sich in der Praxis immer wieder bestätigt: Innovation muss sichtbar gemacht werden – und zwar so, dass es für Ihre relevanten Stakeholder zählt.
Das bedeutet:
- Richtung aufzeigen, nicht nur Ergebnisse berichten.
- Innovation als Portfolio strukturieren, nicht als lose Sammlung einzelner Projekte.
- Führungskräften helfen, Innovation nicht als Kostenfaktor zu verstehen – sondern als Quelle langfristiger Wertschöpfung.
Je klarer dieser Zusammenhang vermittelt wird, desto mehr Gestaltungsspielraum entsteht für echte Innovation.
Interesse an mehr?
Sehen Sie sich die vollständige Webinar-Aufzeichnung an oder nehmen Sie Kontakt auf, um gemeinsam auszuloten, wie HYPE Innovation Sie dabei unterstützen kann, das zu messen, was wirklich zählt.
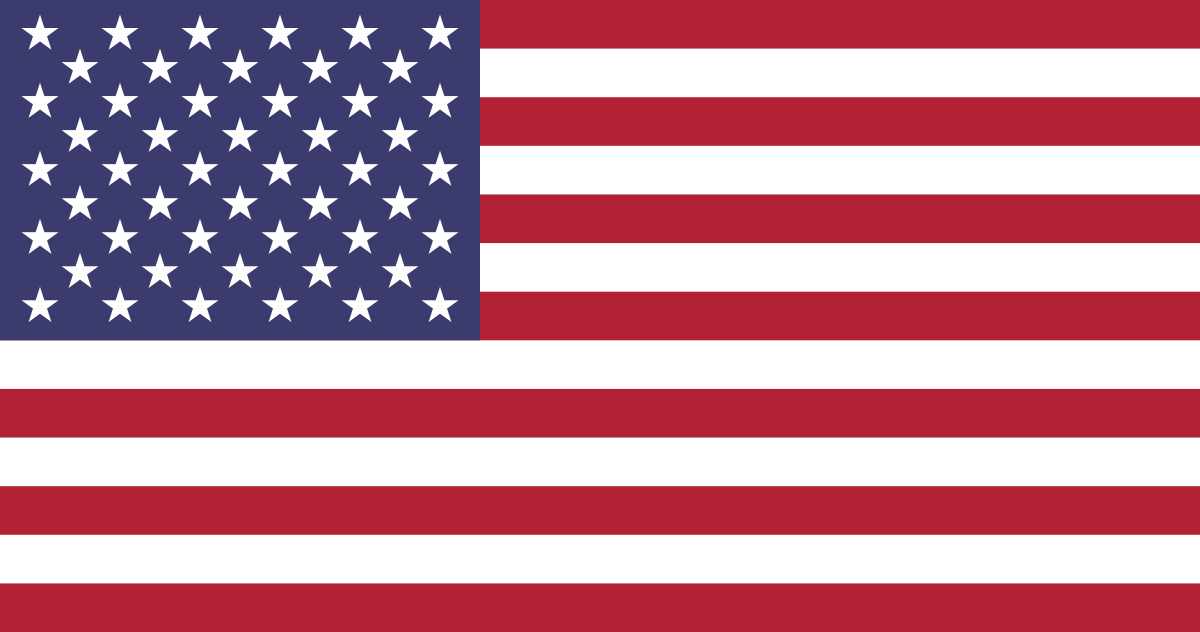

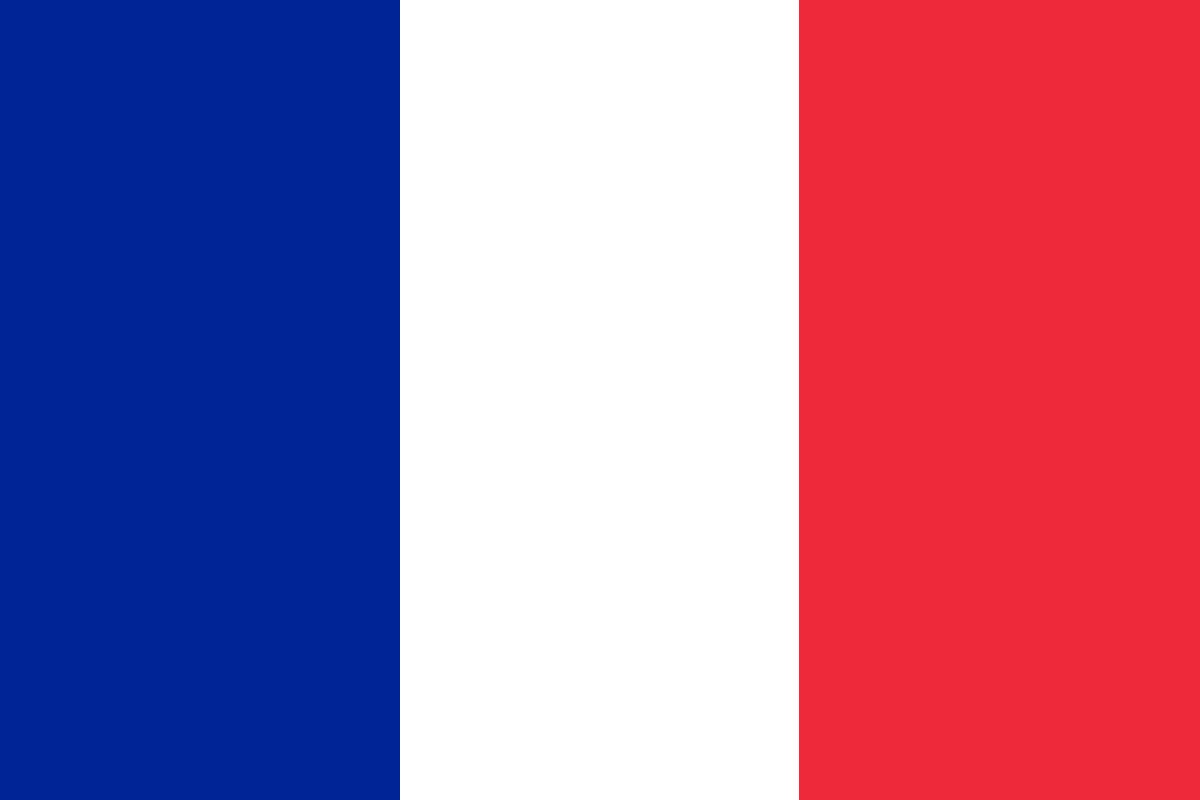





.png?width=370&name=Innovation-Climate%20(2).png)

